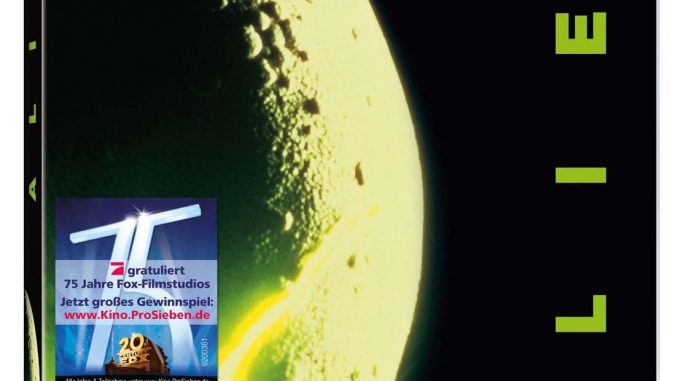
Ich kann mich noch daran erinnern, als ich »Alien« das erste Mal sah. Ich muss so sechs oder sieben gewesen sein. Mein Vater hatte sich den Film in der Videothek als VHS ausgeliehen oder als »Sicherungskopie« von einem Kollegen besorgt. Ich habe mich hinter dem Sofa versteckt und den Film so mitgesehen. Natürlich gab es die berühmte Szene des Chestburster und auch das gruselige Alien, aber am Ende wurde das Monster besiegt und ich hatte keine Schwierigkeiten beim Einschlafen. Da gab es andere Filme aus der Zeit – nach »Poltergeist« konnte ich wochenlang nicht richtig schlafen.
Was mich am meisten fasziniert hat, war der Realismus. Ich fand die Vorstellung fantastisch, einen Beruf zu haben, wo man mit einem Raumfrachter durch den Weltraum fliegt. Ich dachte mir, wenn das mal möglich wäre, würde es genauso sein wie in diesem Film. Ich kannte zu der Zeit schon »Star Wars«, aber der hatte mich als Kind eher kalt gelassen. Das war mir selbst in jungen Jahren klar, dass der Film mit seinen komischen Robotern und Zottelviechern ein Märchen ist. Bei Alien wirkte alles echt. Die Erwachsenen verhielten sich typisch: Sie jammerten und schimpften über dies und jenes und sahen aus wie andere Erwachsene, die in die Fabrik gingen, um zu arbeiten. In diesem Film arbeiteten sie halt im Weltraum.
Über die ganzen Jahre hinweg hat sich an meiner Faszination für den Film nichts geändert. Im Gegenteil, mit jedem Schauen bestätigt sich für mich die Perfektion dieser Produktion. »Alien« ist vor allem ein großartiges Beispiel, welche Elemente ineinandergreifen, um einen wirklich hervorragenden Film hervorzubringen. Da ist zum einen das Drehbuch. Es ist gradlinig und greift sich eine Haupthandlung heraus: die Infiltration des Raumfrachters durch das fremde Wesen und die Dezimierung der Crew mit dem Endkampf der letzten Überlebenden.
Dann gibt es kleinere Handlungselemente, die nahtlos in die Haupthandlung greifen, zum Beispiel Ash, der sich als Roboter entpuppt (wer hätte damit schon gerechnet) und seine schützende Hand über das fremde Wesen hält. Charakterzeichnungen und deren Verhaltensweisen sind immer plausibel. Die Auswahl der unterschiedlichen Charaktere gewährleistet zusätzliche Spannung und sorgt in der Handlung für noch mehr Realismus. Eigentlich ist keine der Figuren (von Ash abgesehen – aber das wissen wir am Anfang noch nicht) etwas Besonderes. Dadurch haben wir nur Offiziere und Mechaniker, die sich auch so verhalten, wie man es von einer Frachterbesatzung erwarten würde, sodass man sich mit allen identifizieren kann. Selbst der Kapitän wirkt von seiner Arbeit eher genervt, als ein strahlendes Vorbild für seine Besatzung zu sein.
Nachdem das Alien an Bord gekommen ist, entpuppt sich keiner als Held. Alle haben Angst, wissen nicht mehr weiter und kämpfen um ihr Überleben. Es gibt wenige Rollen in diesem Film und alle sind hervorragend besetzt. Dazu kommen die Sets. Die Brücke mit ihren tausenden Knöpfen, Hebeln, Kippschaltern ist sehr funktional gehalten. Wie eine große Version des »frühen« Space-Shuttle-Flugdecks. Teilweise versifft und abgenutzt, Krempel liegt herum, als würde hier tatsächlich jemand arbeiten.
Ein Highlight ist für mich der »Reaktorkontrollraum«, wo Ripley später die Selbstzerstörung in Gang setzt. Wir sehen ihr ein paar Minuten zu, während sie an unterschiedlichen Systemen hantiert, um die Sequenz endlich in Gang zu setzen. Mit dieser Liebe zum Detail und der Zeit, die sich der Film für die Einzelheiten nimmt, kommt man sich beim Anschauen ein bisschen wie ein Praktikant vor, der neben der Crew durch das Raumschiff läuft. Das lässt den Horror, den die Raumfahrer durch das fremde Wesen erleben, ungleich stärker spürbar werden. Man ist als Zuschauer ein Teil der Besatzung. Das wird umso deutlicher, wenn man mit der Crew in das abgestürzte außerirdische Raumschiff geht und vor dem bekannten »Space Jockey« steht. Die Proportionen viel zu groß, diese seltsame düstere Umgebung – ich kenne sonst keinen Film, der imstande gewesen wäre, so eine Wirkung bei mir hervorzurufen.
Dann das Alien selbst – designt von dem genialen H. R. Giger -, ein Wesen wie aus einem schrecklichen Albtraum, so ganz anders als das, was man von der Erde kennt. Besonders hier hebt sich der Film von allem ab, was in der Richtung zuvor seinen Weg auf die Leinwand gefunden hat. Die Idee mit dem Parasiten ist nicht neu, das gibt es auf der Erde; eine Geschichte mit Eiern, die in einem fremden Raumschiff entdeckt werden – das existierte als Roman schon in den Fünfzigern. Aber die Art, wie die Ideen miteinander verknüpft und mit dieser visuellen Wucht als Film umgesetzt wurden, das war absolut neu und absolut das Verdienst von Regisseur Ridley Scott.
Überragend ist auch der Soundtrack von Jerry Goldsmith. Schaurig schön, fast schon mystisch sind die Melodien, während das Raumschiff auf den Planeten zufliegt und zur Landung ansetzt. Ansonsten hält sich die Musik sehr zurück und ist unaufdringlich. Auch das trägt zur Atmosphäre bei. In der Anfangssequenz, wo man die Nostromo majestätisch durch den Weltraum fliegen sieht, hört man nur schwach einige metallische Klänge und leises Rauschen. Spätestens, wenn man ein paar Minuten später erfährt, dass die Besatzung schon monatelang unterwegs ist, wird die Leere und Unendlichkeit des Weltraums spürbar – so ganz anders als in »Star Trek«, wo die Reise zum nächsten Stern höchstens ein paar Stunden dauert.
Die Effekte sind – von den aufwendigen Sets mal abgesehen – sparsam. Kein Vergleich zu den Möglichkeiten der Gegenwart. Dennoch hat der Film eine Ausstrahlung, die heute kaum noch erreicht wird. Was Science-Fiction angeht, steht »Alien« bei mir auf Platz 1 – und zwar mit weitem Abstand.
Regie: Ridley Scott
Drehbuch: Dan O’Bannon
Schauspieler: Tom Skerrit, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto
Musik: Jerry Goldsmith
Kamera: Derek Vanlint
Land: USA
Budget: 11 Mio. $
Start: 25.05.1979

2 Trackbacks / Pingbacks