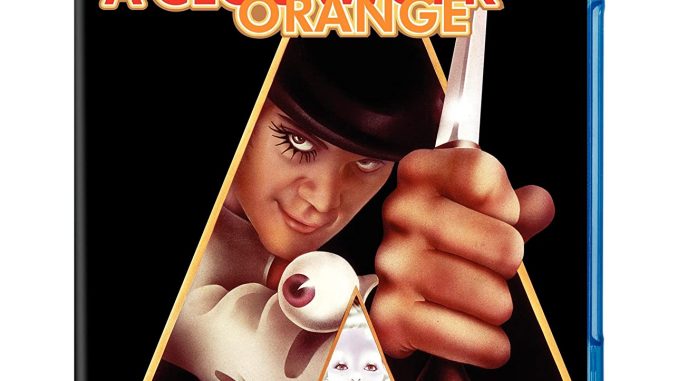
Die gleichnamige Buchvorlage »A Clockwork Orange« von Anthony Burgess gilt als eines der besten britischen Bücher überhaupt. Die ätzende Gesellschaftskritik in Form einer utopischen Erzählung schrieb der Schriftsteller laut eigenen Angaben in nur drei Wochen nieder. Keine zehn Jahre später folgte dann die Verfilmung von Regiewunderkind Stanley Kubrick, der dem Stoff deutlich sichtbar seinen Stempel aufdrückte.
Der Film spielt in der (damals) nahen Zukunft und zeigt das Leben des jungen Alex (McDowell), der mit seiner Jugendgang nachts in fremde Wohnungen einbricht, Frauen vergewaltigt, Männer zu Krüppeln schlägt oder Obdachlose verdrischt. Kubricks optische Version der Zukunft in Form des Produktionsdesigns ist sehenswert, da Sexualität offenbar eine große Rolle spielt und alles sehr schrill ist. Die erste halbe Stunde begleitet der Film die Jugendgang bei ihren Einbrüchen. Eines Tages übertreibt es Alex und erschlägt eine Frau mit einer riesigen Penisskulptur in ihrer Wohnung. Alex wird geschnappt und in den Knast gesteckt. Nach einiger Zeit meldet sich der Junge für ein experimentelles Verfahren, mit denen Verbrecher behandelt werden. Danach sind sie nicht mehr in der Lage, Gewalt anzuwenden. Damit wird Alex aber auch ein Stück seines freien Willens geraubt und er kann sich seinerseits nicht mehr gegen Übergriffe verteidigen, was ihn zu einem wehrlosen Opfer macht.
Die Buchvorlage widmet sich explizit den moralischen Aspekten einer solchen Behandlung und der Frage, ob der Verlust des freien Willens ein akzeptabler Kollateralschaden einer gewaltfreien Welt ist. Burgess positioniert sich in seinem Buch klar für den freien Willen.
Kubricks Film macht es dem Zuschauer nicht ganz so einfach. Der Regisseur zeigt die rohe Gewalt der Jugendgang auf eine damals sehr explizite, fast künstlerisch anmutende Weise. Er verdeutlicht aber auch die trostlose, graue, bürokratische Welt der Regierung mit ihrer neuen »Behandlungsmethode«, bei der als Nebenwirkung nicht nur Ekelgefühle beim bloßen Gedanken an Gewalt auftreten, sondern unglücklicherweise auch beim Hören der Musik von Ludwig van Beethoven. Kubrick bezieht am Ende nicht klar Stellung für diese oder jene Seite, er lässt den Zuschauer sein eigenes Urteil fällen. Durch die unklare Positionierung warfen ihm die Kritiker damals abwechselnd Gewaltverherrlichung und Faschismus vor. Dabei muss ich schmunzelnd daran denken, was ein Film von Quentin Tarantino im England von 1970 wohl ausgelöst hätte.
Jüngere Leute, die Science-Fiction mit »Avengers« oder »Transformers« verbinden, werden wahrscheinlich nicht viel Freude mit diesem Film haben. Kubrick zeigt hier wieder einmal seinen eigenen Stil mit teilweise langen Einstellungen, absurden Szenenbildern, die fast schon »krank« wirken, aber auch Dialogen, die sich Quentin Tarantino locker zum Vorbild hätte nehmen können. Langweilig ist »Uhrwerk Orange« nie, was sicher auch an der hervorragenden Schauspielerleistung von Malcolm McDowell liegt, der durch diesen Film überhaupt erst bekannt wurde.
Für den genialen, synthesizerbasierten Soundtrack zeichnet Wendy Carlos (hieß damals vor der Operation noch Walter Carlos) verantwortlich, die auch die tolle Musik für »Tron« komponierte.
Das etwas abrupte Ende ist eine Folge der US-Version des Romans, der das letzte Kapitel fehlt, in dem Alex aus freiem Willen ein friedliches Leben führt. Die amerikanischen Verleger ahnten, dass das Buch ohne aufgesetztes Happy-End erfolgreicher sein würde, womit sie womöglich recht hatten. Etwas seltsam ist das Ende trotzdem.
Der Film spricht viele Themen an und die Versuche einer detaillierten Interpretation der einzelnen Aspekte gehen sicher schon in die Hunderte. Deswegen und weil mir Interpretationen noch aus dem Schulunterricht verhasst sind, verzichte ich darauf. »Uhrwerk Orange« ist keine leichte Kost, aber das Ansehen lohnt sich dennoch.
Regie: Stanley Kubrick
Drehbuch: Stanley Kubrick
Schauspieler: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri, Michael Bates, Warren Clarke, James Marcus, Michael Tarn
Musik: Wendy Carlos
Kamera: John Alcott
Land: UK, USA
Budget: 2,2 Mio. $
Start: 19.12.1971

Hinterlasse jetzt einen Kommentar